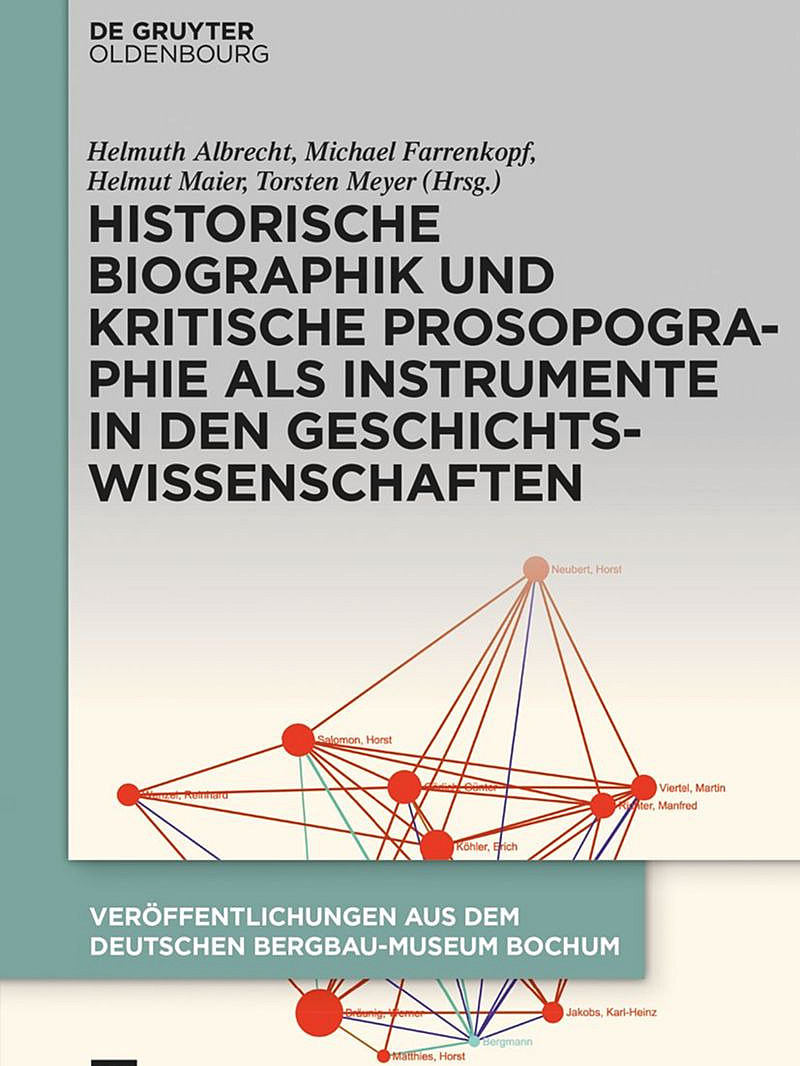Kaiserpriesterinnen (KaiPries)
Das Team der KaiPries ist eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Universität Osnabrück, welche an der Erforschung der epigraphisch belegten Priesterinnen für die Verehrung des römischen Kaiserhauses arbeitet. Unser Arbeitskreis besteht sowohl aus Studierenden, als auch aus MitarbeiterInnen der Alten Geschichte unter der Ägide von Frau Prof. Dr. Christiane Kunst. Das Projekt startete seinerzeit als reguläre Lehrveranstaltung im Wintersemester 2015/16 und wurde nach Abschluss der Veranstaltung ab Sommer 2016 weitergeführt. Seit Dezember 2016 besteht eine Kooperation mit Frau Prof. Dr. Babett Edelmann-Singer von der Universität Regensburg, welche selbst zu den Archiereia Asia Minors forscht. Die Projektgruppe ist nach wie vor offen und versucht auch weiterhin, den interdisziplinären Ansatz auszubauen, um Experten aus anderen Fachbereichen für das Projekt zu gewinnen.
Prof. Dr. Christiane Kunst, Betreuerin des Projekts
Edin Cérmjani, M.Ed., Koordinator des Projekts
Alexander Abel
Dorena Ceylan
Hendrik Hoffmeister
Anna-Friederike Klink
Kathleen März
Christian Möller
Nils Schulz
Janine Selle
Jonas Zandt
Das Projekt Kai-Pries hat mehrere Etappenziele, die nach und nach erreicht wurden und auch noch werden. Im Fokus unseres Erkenntnisinteresses stehen die Kaiserpriesterinnen (flaminicae & sacerdotes) der römischen Kaiserzeit, Priesterinnen, die für die kultische Verehrung des Kaiserhauses zuständig waren. Unsere Bezugsquellen sind epigraphischer Natur. Im Zentrum des Projekts steht die Kai-Pries- Datenbank, die von den Studierenden der Universität Osnabrück seit Oktober 2015 aufgebaut und stetig erweitert wurde. Hierbei handelt es sich um eine relationale Access-Datenbank, die alle Kaiserpriesterinnen der westlichen Provinzen sammelt. Ziel war es immer, alle epigraphisch belegten Kaiserpriesterinnen in diese Datenbank aufzunehmen, um am sie als Tool der Altertumswissenschaft zur Verfügung zu stellen. Vorbild dazu ist die Epigraphische Datenbank Clauss-Slaby. Die Aufnahme der Inschriften in unser internes Corpus erfolgte fast ausschließlich über die EDCS. Die Aufnahme der Inschriften geschah dabei anhand eigens erstellter Tabellen, die im Rahmen der relationalen Datenbankstruktur sortiert und miteinander verknüpft werden konnten. Diese Datenbankstruktur erlaubt es uns, differenzierte Abfragen an unser Corpus zu stellen, die mit bloßen Listen viel mühsamer, wenn nicht sogar völlig unmöglich, bearbeitet werden könnten.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Sie schreiben an einer Arbeit und möchten wissen, wie die geographische Verteilung der Kaiserpriesterinnen in einem bestimmten Zeitraum aussieht? Unsere Datenbank kann diese Informationen im Handumdrehen liefern. Wichtig könnte zudem sein, wie viele der Inschriften, welche Kaiserpriesterinnen in der Gallia Narbonensis bezeugen, im CIL gelistet sind? Kein Problem.
Wir befassen uns in erster Linie mit Priesterinnen des römischen Kaiserkultes. Um genauere Informationen über diese zu gewinnen, haben wir Online in einer Inschriftendatenbank Inschriften bezüglich Priesterinnen in den römischen Provinzen zur Kaiserzeit gesucht. Zur Einschränkung der Vielzahl an Inschriften haben wir diese gezielt mit gängigen Titeln für Priesterinnen gefiltert. Die von uns betrachteten Inschriften lassen sich bisher grob vom frühen 1. Jhd. bis in das späte 4. Jhd. datieren.
Die Anzahl unserer Funde variierte von Provinz zu Provinz, und zum Teil sind Ergebnisse bisher auch ausgeblieben. Allerdings fanden wir in den meisten Fällen mindestens eine Inschrift, bis in den hohen zweistelligen Bereich hinein.
Die Datenbank befindet sich auch jetzt noch im Aufbau, was bedeutet, dass sie regelmäßig erweitert wird, um unser Großziel zu erreichen, am Ende alle epigraphisch bezeugten Kaiserpriesterinnen zu erfassen. Weiterführend zur Arbeit an der Datenbank beschäftigt sich unsere Projektgruppe ebenso mit der Georeferenzierung unseres Corpus mit Hilfe des Programms ArcGIS von Esri. Ob es sich um die Ballung von Kaiserpriesterinnen in einer bestimmten Region handelt oder die Markierung derjenigen Kaiserpriesterinnen, je nachdem welchen Titel sie tragen, all das ist möglich. Unsere Projektgruppe besitzt damit gute Möglichkeiten, um gezielte Fragen an das Corpus zu stellen, welche zu Erkenntnissen führen können, die der Forschung bisher verwehrt blieben.
Seit Frühjahr 2017 haben wir die Provinz Africa proconsularis stärker ins Blickfeld genommen, um eine detailliertere Analyse einer einzelnen Provinz vorzunehmen. Die Africa proconsularis bietet sich als besonders gutes Beispiel an, da es sich hierbei um eine Region handelt, aus der viele Inschriften zum Kaiserkult überliefert sind. Wir erhoffen uns hierdurch gezielte Ergebnisse, indem wir durch die Vernetzung der Datenbank und der Georeferenzierung Denkanstöße erlangen, welche durch kontextualisierende Informationen zu bestimmten Regionen der Africa proconsularis neue Forschungsergebnisse liefern werden.
Wie können wir überhaupt etwas über Kaiserpriesterinnen wissen, wie sie hießen, wo sie lebten und wer ihre Verwandten waren? Schließlich ist seit der Antike reichlich viel Zeit vergangen. Es stellt sich also die Frage nach den Quellen, aus denen wir unsere Informationen beziehen. Und es gibt eine Quellengattung, die uns besonders viel über lokale Persönlichkeiten (Stadträte, Priester, Bürger etc.) verrät, die in der Literatur der großen römischen Historiographen wie Tacitus, Cassius Dio oder Livius meist nicht auftauchen. Die Rede ist von Inschriften, die, in Stein gemeißelt, die Jahrtausende überdauerten.
Inschriften wurden aus den verschiedensten Gründen hergestellt, deren Sinn und Zweck meistens aus ihrem Text hervorgeht. So gibt es im Falle der Kaiserpriesterinnen Grabinschriften, die für sie selbst oder von ihnen für Verwandte hergestellt wurden, oder auch Ehreninschriften, etwa wenn der Rat einer Stadt den Wunsch hatte, die Verdienste einer Priesterin zu würdigen. Besonders ist dies der Fall, wenn Kaiserpriesterinnen sich finanziell am Bau von Gebäuden oder architektonischen Monumenten beteiligt hatten. Aber auch Weihinschriften gehören dazu, die die Priesterinnen zu Ehren einer Gottheit oder eines Herrschers/einer Herrscherin anfertigen ließen.
Nun haben wir unsere Quelle, und dann? Es ist leider überhaupt nicht so, dass wir eine frisch entdeckte Inschrift lesen könnten wie ein Buch. Denn obwohl Inschriften die Zeit überdauern, erleiden sie dennoch häufig Schaden, sodass sie in Teilen schwer oder bisweilen gar nicht zu entziffern sind. Um jetzt aus einer Inschrift Informationen zu gewinnen, gibt es eine historische Hilfswissenschaft: die Epigraphik.
Die Epigraphik beschäftigt sich mit der Erforschung von Inschriften als Quellen und versucht, diese für die historische Forschung aufzubereiten. Wichtig sind dabei vor allem gute altsprachliche Kenntnisse, im Falle der Kaiserpriesterinnen Griechisch und Latein. Dazu kommt, dass antike Inschriften oftmals ganz eigene Formulierungen und Abkürzungen beinhalten, die für die Zeitgenossen klar, von uns heute jedoch erst erlernt werden müssen.
Wie sieht das Ganze also in der Praxis aus? Hier ist eine Beispielinschrift aus Hadrumetum (heute Sousse) in Tunesien. Der obere Text zeigt die originale Variante ohne Auflösung der typischen Abkürzungen, während der untere die nach den Regeln des Leidener Klammersystems komplettierte Version enthält.
Original
Avidiae C f Vitali / flam perp coloniae C I K/ Cn Salvius Saturninus / flam perp / ob merita
Aufgelöst
Avidiae C(ai) f(iliae) Vitali / flam(inicae) perp(etuae) coloniae C(oncordiae) I(uliae) K(arthaginiensis) / Cn(aeus) Salvius Saturninus / flam(en) perp(etuus) / ob merita
Auf Deutsch übersetzt heißt es ungefähr Folgendes:
Für Avidia Vitalis, Tochter des Gaius und flaminica (Kaiserpriesterin) Karthagos auf Lebenszeit, aufgrund ihrer Verdienste, von Gnaeus Salvius Saturninus, flamen (Kaiserpriester) auf Lebenszeit.
Die Formel ob merita (aufgrund der Verdienste) identifiziert diese Inschrift klar als Ehreninschrift, die für die Kaiserpriesterin Avidia Vitalis auf Veranlassung eines Kaiserpriesters namens Gnaeus Salvius Saturninus angefertigt wurde. Zudem wissen wir, dass sie eine Priesterin der Stadt Karthago war, die hier mit ihrem offiziellen Namen colonia Concordia Iulia Karthaginiensis genannt wird. Dass dabei so viele Abkürzungen verwendet wurden, hat wohl vor allem ökonomische Gründe, schließlich ist das Herstellen einer Inschrift alles andere als ein billiges Unterfangen. Also kürzte man am liebsten an den Stellen, deren Bedeutung jedem Leser bekannt war. So kürzten die Römer fast immer ihre Vornamen (Pränomina) ab, von denen es nur sehr wenige gab. Auch der Name der Stadt konnte von Zeitgenossen problemlos identifiziert werden, wenn man bedenkt, dass die Inschrift nicht weit von Karthago entfernt aufgestellt wurde.
Auch in der Gegenwart gibt es zahlreiche Abkürzungen, deren Bedeutung allgemein bekannt ist, so z. B. Dr. für Doktor oder geb. für geboren. Für Historiker, die ja nicht in diesem gesellschaftlichen Kontext aufgewachsen sind, sondern sich von außen hineinarbeiten müssen, ist es manchmal gar nicht so leicht, die für Zeitgenossen selbstverständlichen Abkürzungen zu entziffern. Doch auch dafür gibt es eigens angefertigte Verzeichnisse von Abkürzungen, die immer wieder auf Inschriften auftauchen.
Wie wir in der Inschrift zu Ehren der Kaiserpriesterin Avidia Vitalis gesehen haben, gibt allein der Inschriftentext eine Menge Informationen preis. Aber es gibt noch viel mehr äußere Informationen, die bei der epigraphischen Arbeit berücksichtigt werden müssen, so z. B. die Datierung der Inschrift, ihr Fundort, die Zeitschrift, in der sie publiziert wurde, sowie eventuelle Verweise zu wissenschaftlicher Sekundärliteratur, in der die Inschrift bereits erwähnt oder behandelt wurde. All dies sorgt dafür, dass wir eine große Menge an Daten haben, die irgendwie geordnet werden muss. Dafür verwenden wir eine Datenbank, aufgebaut mit dem Programm Microsoft Access.
Was sind die Vorteile einer Datenbank?
Der große Vorteil einer Datenbank liegt darin, dass Informationen zu einzelnen Inschriften schnell gesichtet werden können. Darüber hinaus erleichtert sie auch den Vergleich von Informationen aus verschiedenen Inschriften. Möchte man beispielsweise wissen, wie viele Priesterinnen den Namen Avidia trugen, muss man nur in der Tabelle Priesterinnen die Spalte name_1 konsultieren, in der alle Namen aller bekannten Priesterinnen aufgelistet sind. So erfährt man, dass nur eine Priesterin mit dem Namen Avidia bekannt ist.
Eine digitale Datenbank kann auch Grundlage für andere Projekte sein. So haben wir von der Alten Geschichte beispielsweise mit der Datenbank und mithilfe des geoinformatischen Programmes ArcGIS der Firma ESRI eine Karte erstellt, auf der alle Orte verzeichnet sind, an denen Inschriften gefunden oder an denen Kaiserpriesterinnen gewirkt haben. Wir haben den Informationsgehalt der Datenbank in eine andere Form gegossen, um ihn aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Wie ist die Datenbank aufgebaut?
Es mag von außen betrachtet einfach klingen, die vorhandenen Daten zu ordnen, doch dem ist überhaupt nicht so. Unsere jetzige Datenbank hat eine lange „Evolution“ hinter sich, während der sie steten Optimierungsprozessen unterzogen wurde. Aktuell sieht sie so aus, dass die Informationen in verschiedenen Tabellen untergebracht sind. Das liegt daran, dass zu jeder Information verschiedene weiterführende Informationen vorhanden sind. So kann jede Priesterin einen oder mehrere Namenteile, eine bestimmte „Berufs“-Bezeichnung, einen Ort, für den sie zuständig ist, und einen, aus dem sie kommt, haben. Daher bietet es sich an, Informationen, die nur die Priesterin betreffen, in einer eigenen Tabelle zu präsentieren, während andere Tabellen beispielsweise für Inschriften da sind, die nur Informationen über diese enthalten. Dabei stehen viele Tabellen über IDs oder Primärschlüssel miteinander in Beziehung. Will man z. B. von einer bestimmten Inschrift zu den Infos über die Priesterin gelangen, findet man die ID der Priesterin in derselben Zeile der Tabelle, wo auch Informationen über die Inschrift enthalten sind. Durch die Kopier- und Suchfunktion kann man in der Tabelle Priesterinnen dieselbe ID und damit die zugehörige Priesterin finden.
Für das Projekt KaiPries wurden aus der Datenbank ‚ Clauss-Slaby‘ zunächst solche Inschriften ausgewählt, die folgende Wörter enthielten: flaminica(e), flamen, sacerdos. Aufgrund technischer Probleme hinsichtlich der Endungen wurden brauchbare Inschriften teils händisch sortiert. Diese wurden in einer eigenen Datenbank erfasst. Mit Hilfe einer Georeferenzierung wurden die Inschriften (und deren Inhalte) kartographisch verortet. Auf diese Weise können Aussagen über die Verteilung der Inschriften innerhalb des römischen Gebietes getroffen werden. Außerdem können quantitative Analysen u.a. der Aufstellungsorte sowie Fundorte durchgeführt werden. Darüber hinaus bietet sich für Untersuchungsgegenstände eine historische Netzwerkanalyse an, die nach einer Beziehung zwischen den einzelnen Kaiserpriesterinnen und anderen Personen, Informationen sowie Orten fragt. Zunächst galt es, Beziehungen zwischen den ausgewählten Inschriften herzustellen. Hierzu wurden bereits Soziogramme erstellt und jeweils mit den anderen Inschriften verglichen. Je nach Auslegung weiterer Fragestellungen kann das Netzwerk beliebig erweitert werden. Zur Zeit wird die „Basisdatenbank“ sukzessive um solche Inschriften erweitert, in denen eine Beziehung zu einer Kaiserpriesterin – z.B. aufgrund der Nennung von Namen des Stifters oder verwandtschaftlichen Beziehungen in der Inschrift – vermutet wird. Auf diese Weise soll ein umfangreiches Netzwerk entstehen, mit Hilfe dessen Informationen über die Kaiserpriesterinnen und deren Umfeld gewonnen werden können.
Zwar bereitete es zunächst keine Probleme die Methoden der Prosopographie und der Netzwerkanalyse sozusagen ‚intuitiv‘ anzuwenden. Jedoch ist uns im Zuge des Arbeitsprozesses aufgefallen, dass wir die beiden Methoden nicht klar voneinander abgrenzen konnten. Deshalb haben wir uns intensiv mit den Begriffen befasst und geprüft, welche Auffassungen in der Forschung vertreten werden. Unser Ziel ist es, die Begriffe transparent anzuwenden. Deshalb werden im Folgenden kurz der Diskurs in der Forschung zu den Begriffen vorgestellt, auf den Zusammenhang und die Unterschiede hingewiesen, die Probleme und Schwierigkeiten nachgezeichnet und aufgezeigt, welche Methode sich für welchen Forschungsgegenstand eignet. [1]
[1] Hierbei verfolgt das Projekt keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit der in der Forschung kursierenden Literatur, insbesondere nicht zur Netzwerkforschung. Siehe hierzu auch Anm. 6.
Netzwerkanalyse
Der Begriff Netzwerkanalyse scheint in den einzelnen Wissenschaften recht nebulös. [1] So konstatiert Reinhard:
„Inzwischen redet und schreibt jedermann […] von Netzwerken, sodass dieses Wort neben dem noch beliebteren Diskurs zur zweithäufigsten Leerformel der Geschichtswissenschaft verkommen ist.“ [2]
Dieses Zitat suggeriert, dass es aufgrund der vielseitigen und unklaren Verwendung des Begriffs schwierig ist, eine exakte Definition aufzustellen. Marx kritisiert, dass „Die Breite des Netzwerkbegriffs in der Geschichtswissenschaft – vom rein metaphorischen Gebrauch bis zur streng sozialwissenschaftlichen Anwendung in quantifizierender Form – und seine Kombinationsmöglichkeit mit anderen (soziologischen) Theorieangeboten […] zu einer Flut von Netzwerkforschungen geführt“ haben.[3] Hiermit führt er keine exakte Definition an oder erklärt, was er unter dem Begriff versteht. Mehr Aufschluss darüber, was eine Netzwerkanalyse ist, kann aus Abgrenzungsbemühungen zwischen dem Zusammenhang und den Unterschieden zwischen den beiden Methoden erlangt werden.
[1] Auf einen umfassenden Forschungsüberblick wird an dieser Stelle verzichtet, da es unzählige Werke zur Netzwerkforschung gibt und dieses Projekt sich nicht zur Aufgabe macht, den Forschungsstand nachzuzeichnen.
[2] Reinhard, W.: Kommentar. Mikrogeschichte und Makrogeschichte. In: Thiessen, H. von, Windler, C. (Hg.): Nähe in der Ferne. Personale Verflechtung in den Außenbeziehungen der Frühen Neuzeit (= Zeitschrift für Historische Forschung, Beihefte 36). Berlin 2005, S. 135-144. zitiert nach Düring et al. 2016, S. 5.
[3] Vgl. Marx 2016, S. 83.
Zusammenhang und Unterschiede zwischen Prosopographie und Netzwerkanalyse
Eine Abgrenzung der Netzwerkanalyse von der Prosopographie deuten Düring und Keyserlingk an:
„Neben der bisher üblichen deskriptiven Untersuchung des sozialen Umfeldes historischer Akteure existieren seit einiger Zeit auch Analysemethoden, mit denen das soziale Netzwerk von Personen und Organisationen systematisch untersucht werden kann. Dieser Netzwerkansatz nimmt weniger die Akteure selbst, als vielmehr die Beziehungen zwischen ihnen in den Blick.“ [1]
Damit folgen sie der in den Sozialwissenschaften verbreiteten Überzeugung, dass nicht Einzelindividuen oder soziale Gruppen die Bausteine der sozialen Welt seien, sondern soziale Beziehungen, die sich in Netzwerken manifestierten. Gramsch bezeugt, dass „ein erstes, schon relativ gut etabliertes Untersuchungsfeld […] sich auf dem Gebiet der Prosopographie spätmittelalterlicher Eliten, insbesondere im kirchlichen Bereich“ eröffne. [2] Er verortet folglich die Prosopographie als Teilgebiet der Netzwerkforschung. Zudem spricht er vom „netzwerkanalytischen Paradigma“ als Oberbegriff [3], womit er auch hier für die Prosopographie als ein Untersuchungsfeld bzw. Teilgebiet der Netzwerkforschung plädiert. Besonders deutlich wird seine Position im folgenden Zitat:
„Ausgehend von dieser Überlegung seien exemplarisch drei tatsächlich vielversprechende Arbeitsfelder mediävistischer Netzwerkforschung benannt: Erstens die Genealogie, zweitens die politische Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters und drittens die prosopografische Erforschung.“ [4]
Gramsch erläutert zudem, was er unter einer netzwerkanalytischen Vorgehensweise versteht. Demzufolge handele es sich um „[Arbeiten], welche sich freilich nur der möglichst exakten Rekonstruktion personaler Netzwerke und nicht deren weiterer mathematischer Analyse widmen“. [5] Während er Prosopographie als Rekonstruktion personaler Netzwerke auffasst, sieht er Netzwerkforschung als mathematische Analysen. Häufig wird in der Forschung bemängelt, dass Netzwerkforschung in der Geschichtswissenschaft als Metapher benutzt wird, weil der mathematische Aspekt nicht berücksichtigt würde (vgl. u.a. Marx). [6] So fehlen in solchen Studien beispielsweise Aspekte einer Graphentheorie, in der Knoten und Kanten zum Bilden von Netzwerken unentbehrlich seien. [7] Eine exakte Differenzierung der beiden Begriffe bleibt allerdings unklar. Für die Geschichtswissenschaft scheint ferner interessant, was Bixler schreibt:
„Die Daten selbst sind mit vergleichsweise geringem Aufwand zu sammeln, zumindest soweit sie […] aus historischer Sekundärliteratur, Prosopografien usw. zu gewinnen sind. Nur selten wird daher auf Primärquellen zurückgegriffen.“ [8]
Auffallend an dieser Bemerkung ist, dass für die Netzwerkanalyse nicht auf Primärquellen zurückgegriffen werden muss, was sich für die Geschichtswissenschaft ggf. als Problem erweisen könnte. Zu dem Aspekt des Sammelns kritisiert bereits Bulst, dass die Prosopographie nicht auf das reine Sammeln beschränkt wird. Dieses mache zwar den größeren Teil der Arbeit aus, dennoch sei eine kurze Auswertungsphase notwendig. [9] Für das Projekt hieße das konkret, dass der erste Schritt mit Hilfe der Prosopographie erfolgt, indem wir Daten aus Inschriften sammeln und in Datenbanken festhalten. Der zweite Schritt besteht in der Anwendung der Netzwerkanalyse, die jedoch davon abhängig ist, welche Fragestellungen wir an unsere Daten herantragen wollen und welche Datenmenge wir zur Verfügung haben.
Als Folgerung lässt sich festhalten, dass sich in der Literatur kaum konkrete Definitionen zu den beiden Begriffen finden lassen. Diese werden zudem häufig nicht trennscharf verwendet. Dieser Befund ist insofern bemerkenswert, als dass der Begriff Netzwerk – wie Reinhard konstatiert hat - stets verwendet wird. Somit bedarf es zwingend einer (Arbeits)Definition als Basis für weitere Studien. Allerdings lässt sich aus den Zitaten ableiten, was der Unterschied zwischen den Begriffen zu sein scheint. Die Prosopographie legt den Fokus auf das Erfassen von Personen bzw. Personengruppen und generiert daraus Personenlisten und Stammbäume. An dieser Stelle sei gegen Dürings und Keyserlingks Auffassung anzumerken, dass für das Projekt ‚Kaiserpriesterinnen‘ das Erstellen von Stammbäumen keineswegs auf einer deskriptiven Ebene erfolgt, sondern auf einer Rekonstruktion basiert und Interpretationsspielraum ermöglicht. Insofern distanziert sich das Projekt von der Vorstellung, die Prosopographie beruhe auf rein deskriptiver Arbeit (jedenfalls gilt das für die Altertumswissenschaften). Die Netzwerkforschung beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen den Personen(gruppen). Hierbei greift sie auf entsprechend aufbereitete Listen aus der Prosopographie zurück. Die Prosopographie ist somit Teilgebiet der Netzwerkforschung und liefert dieser die entsprechende Grundlage. Die Netzwerkanalyse bietet zudem mehr Abfragemöglichkeiten als die Prosopographie. Letztere verfolgt keine Verknüpfungen, während die Netzwerkanalyse von diesen lebt, was u.a. den graphentheoretischen Ansatz sowie analytischen Hintergrund erklärt. Allgemein könnte formuliert werden, dass die Prosopographie Daten einzelner Personen(gruppen) erfasst, während die Netzwerkforschung die Beziehungen zwischen Personen(gruppen) untersucht.
Vergleich der beiden Methoden
Prosopographie | Netzwerkforschung |
Fokus auf Erfassen von Personen(gruppen) (u.a. Erstellung von Personenlisten, Stammbäumen) | Fokus auf Beziehung zwischen Personen(gruppen)
|
Reines Sammeln von Daten | Basierend auf mathematischen Hintergrund (Graphentheorie: Knoten und Kanten) = analytisch |
Ein Teilgebiet der Netzwerkforschung (Grundlage bzw. Hilfsmittel) | Oberbegriff (Greift bestenfalls nicht auf Quellen zurück, sondern auf Listen / aufbereitete Daten) |
Keine Verknüpfung von Daten | Verknüpfung von Daten |
[1] Düring / Keyserlingk 2015, S. 338. Den deskriptiven Charakter der Prosopographie erwähnt auch Gramsch 2016, S. 97.
[2] Vgl. Gramsch 2016, S. 85f.
[3] Ebd. S. 85.
[4] Ebd. S. 89.
[5] Ebd., S. 86.
[6] Ebd. S. 85, aber auch Düring et al. 2016, S. 9, verweisen auf dieses Problem.
[7] Vgl. hierzu die Ausführungen und dazugehörigen Graphiken Gramschs 2013, S. 47f. Zudem bieten Gamper et al. 2015 Einblicke in den Zusammenhang zwischen Netzwerkanalyse und Graphentheorie.
[8] Bixler 2016, S. 55.
[9] Vgl. Bulst 1986, S. 3.
Probleme
Die größte Schwierigkeit in der Verwendung der beiden Methoden besteht wohl darin, dass eine geeignete Basis geschaffen werden muss. Soll oder darf die Netzwerkanalyse als Metapher oder im exakt mathematischen Sinne verwendet werden? Für Letzteres sind mathematische Kenntnisse erforderlich, in die sich Historiker/innen ggf. erst einarbeiten müssten. Zudem eigne sich eine Netzwerkanalyse nur bei großen Datenmengen, da ansonsten keine „seriöse“ Rekonstruktion möglich sei. [1] Hierbei stellt sich zunächst die Frage, was unter ‚großen Datenmengen‘ zu verstehen ist? Für die Antike beispielsweise können im Vergleich zur Neuzeit längst nicht die möglicherweise erforderlichen Datenmengen herangezogen werden, da einfach begrenztes Material zur Verfügung steht. Darüber hinaus scheint das Argument der seriösen Rekonstruktion bei geringen Daten unangemessen zu sein, da die Geschichtswissenschaft – zumindest für die Antike gesprochen – immer an das vorhandene Quellenmaterial gebunden ist. Zudem müsse aufgrund der Lückenhaftigkeit der Überlieferung stets mit einer Verzerrung der Wirklichkeit gerechnet werden. [2] Aus den aufgeführten Zitaten ergibt sich der Aspekt, dass die Netzwerkanalyse nicht auf Primärdaten zurückgreife. Dies kann in der Geschichtswissenschaft problematisch sein, da jede Quelle auch für sich sprechen kann (Vetorecht der Quellen). [3] Deshalb sollte bei aller Quantifizierung der Daten stets mit Sorgfalt an eine Datenbasis für Netzwerkstudien herangegangen werden. Gramsch konstatiert hierzu, dass die Schnittstelle zwischen Quellenkritik und Quantifizierung nicht verloren gehen dürfe. [4] Für die meisten netzwerkanalytischen Fragestellungen würden vergleichbare Daten in recht hoher Dichte herangezogen, die nicht immer in den Quellen so zu finden seien, wie man sie gerne hätte. [5] Dabei sei zu kritisieren, dass der Ausgangspunkt bei der Netzwerkanalyse nicht das Erkenntnisinteresse sei, sondern die Quellenlage. [6] Im Grunde sei eine Netzwerkanalyse geeignet für quantitative Auswertungen in Form von Fragebögen. Deshalb müssten für geschichtswissenschaftliche Studien eigens Strategien zur Gewinnung von Daten entwickelt werden. [7] Bei der Untersuchung von menschlichen Beziehungen ist in Frage zu stellen, ob eine zu analytische Herangehensweise überhaupt möglich ist - können Beziehungen zwischen Menschen in einem Raster oder Modell dargestellt werden?
[1] Vgl. Bixler / Reupcke 2016, S. 105; Eck 1993, S. V, führt ebenfalls das Problem der Repräsentativität an.
[2] Vgl. Gramsch 2016, S. 88.
[3] Vgl. hierzu auch Bixler / Reupcke 2016, S.106.
[4] Vgl. Gramsch 2016, S. 92; ebenso Düring / Keyserlingk 2015, S. 343.
[5] Vgl. Bixler / Reupcke 2016, S. 105.
[6] Ebd. S. 107.
[7] Ebd. S. 106.
Welche Methode eignet sich für welchen Forschungsgegenstand?
An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, welche Methode für welchen Untersuchungsgegenstand angemessen ist. Für eine prosopographische Untersuchung muss die Fragestellung vor dem Sammeln festgelegt sein [1], während sich bei der Netzwerkanalyse weitere Fragen aus dem Arbeitsprozess ergeben können. In unserem Fall erweitern wir das Netzwerk beständig um Beziehungen zu Verwandten, anderen Priesterinnen, weiteren Amtsinhabern usw. Die Prosopographie lässt nur bestimmte Auswertungen zu. Fragestellungen, die an diese Methode herangetragen werden können, sind beispielsweise, wer zu welchem Personenkreis gehört oder wer welchem Stand angehört. Auf diese Weise erfolgt eine Strukturierung bzw. Kategorisierung der Daten. Es werden Repräsentanten einer Gruppe ausfindig gemacht. Um aber die Frage nach dem WER tiefgehender zu beantworten, ist die Untersuchung von Beziehungen ebenfalls lohnenswert. Hierbei geht es darum, welche Beziehung Person x zu Person y hat oder wie sie sich gegenüber bestimmten Personenkreisen verhält. Die Prosopographie fokussiert Karrieren und Lebensläufe einzelner Personen, die gesammelt werden. Die Netzwerkanalyse hingegen fragt vor der Einbettung der Daten in den sozialen Kontext danach, warum wer welche Karriere angestrebt hat, z.B. aus sozialen, familiären oder politischen Gründen. Für das Projekt bedeutet das letztlich konkret, dass die Daten zu den Kaiserpriesterinnen vor dem Hintergrund der Frage ‚Wer waren sie‘ in einer Datenbank gesammelt werden. Anschließend werden Fragen nach Beziehungen gestellt, also nach dem ‚Warum‘ gefragt. Ob die Netzwerkanalyse dabei metaphorisch oder exakt mathematisch verwendet wird, wird sich aus dem Umfang und Inhalt des Materials ergeben.
Prosopographie | Netzwerkforschung |
Frage muss vor Sammeln festgelegt sein | Weitere Fragen ergeben sich aus der Analyse |
Wer gehört zu welchem Personenkreis („Wer waren sie“? = Strukturierung / Kategorisierung) | Welche Beziehungen hat Person x zu Person y oder Gruppe z |
Festhalten von Karrieren oder Lebensläufen | Warum hat wer welche Karriere angestrebt? |
[1] Vgl. Bulst 1986, S. 4.
Literatur
Alföldy 1993 = Alföldy, G.: Die senatorische Führungselite des Imperium Romanum unter Marcus Aurelius. Möglichkeiten und Probleme der prosopographischen Forschungsmethode, in: Eck, W. (Hg.): Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie. Kolloquium Köln 24.-26. November 1991, Köln 1993, S. 61-70.
Bixler 2016 = Bixler, M.: Die Wurzeln der Historischen Netzwerkforschung, in: Düring, M. / Eumann, U. / Stark, M. / Keyserlingk, L. von (Hg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) zur Methodenforschung, herausg. Von Prof. Dr. C. Leggewie), Band 1). Berlin 2016, S. 45-61.
Bixler / Reupcke 2016 = Bixler, M. / Reupcke, D.: Von Quellen zu Netzwerken, in: Düring, M. / Eumann, U. / Stark, M. / Keyserlingk, L. von (Hg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) zur Methodenforschung, herausg. Von Prof. Dr. C. Leggewie), Band 1). Berlin 2016, S. 101-122.
Bulst 1986 = Bulst, N.: Zum Gegenstand und zur Methode von Prosopographie, in: Bulst, N. / Genet, J.-P. (Hg.): Medieval lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography (Proceedings of the First International Interdisciplinary Conference on Medieval Prosopography. University of Bielefeld, 3-5 December 1982), Kalamazoo 1986, S. 1-16.
Düring / Keyserlingk 2015 = Düring, M. / Keyserlingk, L. von: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften. Historische Netzwerkanalyse als Methode für die Erforschung von historischen Prozessen, in: Schützeichel, R. / Jordan, S. (Hg.): Prozesse. Formen, Dynamiken, Erklärungen, Wiesbaden 2015, S. 337-350.
Düring et al. 2016 = Düring, M. / Eumann, U. / Stark, M. / Keyserlingk, L. von: Einleitung, in: dies. (Hg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) zur Methodenforschung, herausg. Von Prof. Dr. C. Leggewie), Band 1). Berlin 2016, S. 5-10.
Eck 1993 = Eck, W.: Vorwort, in: ders. (Hg.): Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie. Kolloquium Köln 24.-26. November 1991, Köln 1993.
Gamper et al. 2015 = Gamper, M. / Reschke, L. / Düring, M. (Hg.): Knoten und Kanten III. Soziale Netzwerkanalyse in der Geschichts- und Politikforschung, Bielefeld 2015.
Gramsch 2013 = Gramsch, R.: Autorität im Netzwerk der Fürsten. Friedrich II. und Heinrich (VII.) im Anerkennungswettstreit (1231-1235), in: Seibert, H. / Bomm, W. / Türck, V. (Hg.): Autorität und Akzeptanz. Das Reich im Europa des 13. Jahrhunderts, Ostfildern 2013, S. 43-64.
Gramsch 2016 = Gramsch, R.: Zerstörter oder verblasste Muster? Anwendungsfelder mediävistischer Netzwerkforschung und das Quellenproblem, in: Düring, M. / Eumann, U. / Stark, M. / Keyserlingk, L. von (Hg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) zur Methodenforschung, herausg. Von Prof. Dr. C. Leggewie), Band 1). Berlin 2016, S. 85-99.
Marx 2016 = Marx, C.: Forschungsüberblick zur Historischen Netzwerkforschung. Zwischen Analysekategorie und Metapher, in: Düring, M. / Eumann, U. / Stark, M. / Keyserlingk, L. von (Hg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) zur Methodenforschung, herausg. Von Prof. Dr. C. Leggewie), Band 1). Berlin 2016, S. 63-84.
Rekonstruktion der familiären Verknüpfungen einer flaminica
Hendrik Hoffmeister
Die folgenden Ausführungen sollen veranschaulichen, wie ausgehend von einer speziellen Inschrift familiäre Bezüge und örtliche Verbindungen durch den Vergleich mit anderen Inschriften rekonstruiert werden können. Zugleich soll dieses Beispiel die oftmals auftretende Mehrdeutigkeit epigraphischer Informationen präsentieren, die exakte Bestimmungen verbietet, aber zugleich den Raum für Spekulationen und weitere Recherche eröffnet. Im Folgenden soll die Rekonstruktion eines Zweiges der gens Annia erfolgen, zu welcher mehrere von uns ermittelte Priesterinnen gehörten und die daher für eine Untersuchung möglicher Beziehungen und Verwandtschaften geeignet erscheint:
Grundlage dieser Rekonstruktion stellt eine in das 2. Jahrhundert n.Chr. datierte Inschrift aus Thamugadi im heutigen nördlichen Algerien dar (EDCS-24500252). In dieser Weihinschrift für Fortuna Augusta werden die flaminica Cara sowie ihre Schwester Tranquilla als Angehörige der gens Annia und als Töchter eines Marcus benannt. Zugleich werden, ohne genauere Beschreibung ihrer gesellschaftlichen Funktion, zwei Personen namens Annius Protus sowie Annius Hilarus angeführt, wobei Annius Hilarus als vermeintlicher Vater von Cara und Tranquilla zu identifizieren ist, was auch von Seiten der historischen Forschung unterstützt wird. [1] So sei diese Inschrift gemäß Werner Eck so zu bewerten, dass Annius Protus gemeinsam mit seinem Mitfreigelassenen Annius Hilarus und dessen Töchtern Cara und Tranquilla diese Weihinschrift initiiert habe. Für diese Bezeichnung des Annius Protus und des Annius Hilarus als Freigelassene gibt es eindeutige epigraphische Hinweise. Hierfür ist eine weitere Inschrift aus Thamugadi zu betrachten, welche die Stiftung einer Weihinschrift für Victoria Parthica Augusta nach dem Testament eines Marcus Annius Martialis beinhaltet (EDCS-20100181). Hierin werden die soeben benannten Protus und Hilarus und noch zusätzlich ein gewisser Eros als Initiatoren der Inschrift angeführt und als liberti, also Freigelassene, des Marcus Annius Martialis aus der tribus Quirina benannt. Dieser wird hinsichtlich seiner militärischen Tätigkeit vielfältig beschrieben, was wiederum Schlüsse auf bestimmte räumliche und historische Bezüge erlaubt. So sei Marcus Annius Martialis ein Soldat der legio III Augusta gewesen, durch deren Gesandten Lucius Munatius Gallus Thamugadi ca. 100 n.Chr. als Colonia Marciana Traiana Thamugadi gegründet worden war. Zudem war Martialis ein decurio in der ala Pannonia, welche in Gemellae (etwa 140 km südwestlich von Thamugadi) stationiert war. Schließlich wird Martialis zusätzlich als Zenturio der legio XXX Ulpia Victrix benannt, der ehrenhaft von Trajan aus dem Militärdienst entlassen worden sei. Die legio XXX Ulpia Victrix war gegen 100 n.Chr. für die Dakerkriege ausgehoben worden und zunächst an der Donau, seit 122 n.Chr. dann im niedergermanischen Legionslager Vetera I in der Nähe der Colonia Ulpia Traiana (dem heutigen Xanten) stationiert. Somit ist festzuhalten, dass diese Inschrift sehr konkrete Auskünfte über den militärischen Hintergrund des Marcus Annius Martialis erteilt, welcher als patronus der bereits in der anfänglich thematisierten Inschrift hervortretenden Hilarus sowie Protus zu identifizieren ist. Als nicht gesicherte, aber eventuelle Grabinschrift des Marcus Annius Martialis ist eine Inschrift aus dem ca. 180 km nordöstlich von Thamugadi befindlichen Calama zu benennen (EDCS-04000076). Diese lässt jedoch aufgrund ihrer relativ wenigen Informationen über einen […]annius Martialis, der 67 Jahre gelebt habe, nur mutmaßen. Für einen Zusammenhang dieser Grabinschrift mit Marcus Annius Martialis spricht dennoch der Fundort Calama, welcher zur tribus Quirina gehörte, die in der vorigen Inschrift ebenfalls als die tribus des Martialis benannt wird. [2] Auch für die Freigelassenen Protus und Hilarus lassen sich Grabinschriften rekonstruieren. So liegt im Falle des Protus eine ebenfalls in Thamugadi befindliche Inschrift vor (EDCS-68400002), welche angibt, dass Marcus Annius Protus 50 Jahre gelebt habe und gemeinsam mit seiner vermeintlichen Tochter Annia Africana, die 12 Jahre alt wurde, begraben wurde. Für Hilarus hingegen liegt im etwa 180 km westlich von Thamugadi gelegenen Castellum Vanarzanense eine Grabinschrift vor, laut welcher er 50 Jahre alt geworden sei und seine Söhne Paetinus und Annianus ihm diese Inschrift gestiftet hätten (EDCS-60200068). An dieser Stelle ist wieder auf die These Werner Ecks zur ersten Inschrift zu verweisen, dass es sich bei Hilarus um den Vater von Cara und Tranquilla handele. Dies erscheint angesichts der vermittelten Informationen sinnvoll, wirft aber hinsichtlich dieser Grabinschrift dennoch Fragen auf, da hierbei lediglich zwei Söhne des Hilarus in Erscheinung treten, während die beiden Töchter, und vor allem die mit dem sozial bedeutenden Amt der flaminica versehene Cara, unerwähnt bleiben. Daher ist weiterhin zu diskutieren, inwiefern die familiären Verknüpfungen in diesen Inschriften plausibel erscheinen.
An dieser Stelle endet die bisherige Auseinandersetzung mit dieser flaminica und ihrer Familie. Zusätzliche etwaige Verknüpfungen mit räumlich und nominal nahestehenden Personen bieten sich aufgrund weiterer epigraphischer Befunde zwar an, erscheinen aber noch nicht in diese Ausführungen integrierbar und werden in weiteren Arbeitsschritten hinsichtlich einer Eignung überprüft. Auch wenn hiermit erst wenige Mitglieder der gens Annia ausgehend von der ursprünglichen Inschrift der flaminica ermittelt werden konnten und die familiären Beziehungen in vielen Fällen noch ungeklärt bleiben, hat dieses Beispiel hoffentlich diverse Aspekte verdeutlicht. So ist es möglich, mithilfe nominaler Ähnlichkeiten und Verweise auf Abstammung Vermutungen über Verwandtschaften zu tätigen. Wenn diese vermeintlichen Verwandtschaften zusätzlich eine geographische Nähe aufweisen, belegt dies die Vermutung zwar nicht zwingend, aber unterstützt diese definitiv.
Zwar entfernte sich diese Rekonstruktion immer weiter von der anfangs thematisierten flaminica und konzentrierte sich letztlich mehr auf Marcus Annius Martialis, aber dennoch ist dies als erfolgreicher Ansatz zu verstehen, um die familiären Verbindungen und Herkunftsorte dieser Kaiserpriesterin zu ermitteln. Dennoch ist einzugestehen, dass derartige Rekonstruktionen auf epigraphischer Basis schnell an ihre Grenzen stoßen können, da das Material äußerst begrenzt ist, sodass jeder Fund einer weiteren relevanten Inschrift einen Glücksfall darstellt. Zugleich sollte angesichts geringer Quantität vielmehr versucht werden, die einzelnen Inschriften möglichst detailliert auszuwerten, um eine größtmögliche Zahl an familiären und geographischen Bezügen herstellen zu können.
[1] Eck, Werner: Monument und Inschrift. Gesammelte Aufsätze zur senatorischen Repräsentation in der Kaiserzeit, Berlin 2011, S.130.
[2] Vgl. Grotefend, Carl Ludwig: Imperium Romanum Tributim Descriptum: Die geographische Vertheilung der römischen tribus im ganzen römischen Reiche, Hannover 1863, S.171.
Kaiserpriesterinnen in Thugga
Alexander Abel
Als eine an epigraphischen Zeugnissen reichhaltige Region erwies sich die römische Provinz Africa proconsularis und insbesondere die numidische Siedlung Thugga (heute Dougga in Tunesien). Da hier die Aktivität vieler Kaiserpriesterinnen in römischer Zeit durch Inschriften gut dokumentiert ist, konzentrierte sich die Arbeit unserer Projektgruppe zunächst auf die Rekonstruktion sozialer Netzwerke und familiärer Verbindungen einzelner Priesterinnen in Thugga. Ausgehend von den in der Datenbank erfassten Priesterinnen, deren Wirken in Thugga epigraphisch belegt ist, und mithilfe der aus den Inschriften ersichtlichen Angaben (z.B. Namensbestandteile, Verwandtschaftsverhältnis, sozialer Status) sowie zusätzlichen (ggf. hypothetischen) Informationen aus der Sekundärliteratur (insbesondere Bertolazzi o.J., 7-12) ließen sich in drei Fällen somit mehr oder minder umfangreiche familiäre Verbindungen rekonstruieren. Diese können und sollen in den folgenden Beschreibungen nachvollzogen werden.
1. Die Kaiserpriesterin Nahania Victoria, als flaminica perpetua in den Jahren zwischen 185 und 192 und somit während der Herrschaft des Kaisers Commodus in Thugga aktiv, war die Ehefrau eines Quintus Pacuvius Saturus. Dieser übte ein demjenigen seiner Gattin vergleichbares Amt aus: Er war flamen perpetuus sowie augur im ca. 100 km nordöstlich von Thugga gelegenen Karthago. Gemeinsam hatten beide Eheleute einen Sohn namens Marcus Pacuvius Felix Victorianus, über den bisher jedoch keine weiteren Informationen vorliegen (z.B. CIL VIII 26482).
2. Zu Regierungszeiten des Marcus Aurelius hatte Nanneia Instania Fida im Jahr 173 das Amt der flaminica inne. Familiäre Beziehungen dieser Priesterin zu anderen historischen Personen sind nicht belegt. Es wird jedoch angenommen, dass ein gewisser Lucius Instanius Fortunatus, der unter Kaiser Hadrian mehrfach als curator diverser Tempelbauten in Thugga fungierte, ein direkter Vorfahr der Nanneia gewesen sein könnte. Auch Lucius Instanius Commodus Asicius kommt für eine Verwandtschaft mit Nanneia in Frage. Dieser wird auf einer Statue, die in das 3. Jh. n. Chr. datiert wird, als duumvir und aedilis für seine politische Laufbahn geehrt. Da jedoch keine persönlichen Ämter- oder Lebensdaten überliefert sind, ist freilich ungewiss, ob er als ein Vor- oder Nachfahr der Nanneia zu bezeichnen wäre. Klar bezeugt ist hingegen eine Erbverbindung zwischen der Priesterin und Gaius Terentius Iulianus, der sowohl von jener als Erbe eingesetzt wurde als auch von ihr gestiftete Statuen einweihte (CIL VIII 26529). Für eine möglicherweise enge Verwandtschaft liegen keine Zeugnisse vor.
3. Die epigraphischen Zeugnisse zu Asicia Victoria boten aufgrund ihrer Informationsfülle das größte Potential zur Rekonstruktion der Verwandtschaftsverhältnisse. Folgerichtig erwiesen sich die Recherchen – verglichen mit denen zu anderen Kaiserpriesterinnen aus Thugga – als besonders ergiebig. Asicia Victoria, die während der Herrschaft des Septimius Severus in den Jahren 205/206 als flaminica perpetua in Thugga praktizierte, war die Tochter des Asicius Adiutor (CIL VIII 26589). Unklar ist die Zugehörigkeit des „Adiutor“ zum offiziellen Namen, zumal es sich hierbei auch um eine Berufsbezeichnung oder einen informellen Namenszusatz handeln könnte. Eine Beziehung des Asicius (Adiutor) von Berufs wegen zu Iulia Paula Laenitiana, flaminica perpetua unter Antoninus Pius zwischen 138 und 161, liegt insofern vor, als dass er laut Bertolazzi als curator der von ihr gestifteten Bauten belegt ist. Als besonders überraschend und interessant stellte sich während der Recherche die Erkenntnis heraus, dass auch im direkten familiären Umfeld der Asicia Victoria eine weitere flaminica existierte: In der in diversen Inschriften bezeugten Priesterschaft der Vibia Asiciane(s), der gemeinsamen Tochter der Asicia Victoria und ihres Ehegatten Marcus Vibius Felix Marcianus (z.B. CIL VIII 26591), kündigen sich erste Ansätze dynastischer Verhältnisse in Thugga an. Außerdem ist ein gewisser Minervianus überliefert, der, obwohl wir weder über seinen Vor- noch seinen Gentilnamen Kenntnis haben, in der Forschung als Neffe der Asicia Victoria identifiziert wird (CIL VIII 26592) und damit zur Peripherie des familiären Netzwerkes zu zählen ist.
Bibliographie Projekt KaiPries
Adak, M.: Claudia Iasonis, eine Asiarchin aus Lykien, Hermes, 2013, 141 (4), S. 459-475.
Alföldy, G.: Ein senatorisches Ehepaar in Pollentia, ZPE, 47, 1982, S. 201-205.
Alföldy, G.: Flamines provinciae Hispaniae citerioris, Madrid 1973.
Ambaglio, D.: CIL, V, 6435, Epigraphica, 41, 1979, S. 171-175.
Arnaldi, A.: Osservazioni sul flaminato dei Divi nelle province africane, AfrRom, 18, 2010, S. 1630-1645.
Arnaldi, A.: Flamines "nude dicti", flamines civitatis, flamines coloniae nell´Italia romana, Epigrafia, 2006, S. 773-801.
Arnaldi, A. / Giuliani, F.: Sacerdoti municipali della regio VIII (Aemilia), RStudLig, 72-73, 2006/7, S. 141-218.
Barthels, H.: Studien zum Frauenportät der augusteischen Zeit, Fulvia, Octavia, Livia, Julia, München 1963.
Bassignano, M. S.: Culto imperiale al femminile nel mondo romano, in: Raviola F. (Hg.): L´indagine e la rima. Scritti prew Lorenzo Braccesi, Hesperia, 30, 2013, S. 141-187.
Bassignano, M. S.: Flaminato e culto imperiale nella regio X, in: Corda, G. (Hg.): Cultus splendore. Studi in onore di Giovanno Sotgiu, Senorbì 2003, S. 79-103.
Bassignano, M. S.: Flaminato e culto imperiale nelle regiones XI e IX, AIV, 163, 2005, S. 313-353.
Bassignano, M. S.: Il culto degli Arusnati in Valpolicella, Atti e Memorie dell´Ateneo di Treviso, n.s. 17, 1999/00, S. 217-225.
Bassignano, M. S.: Il flaminato imperiale in Italia (regioni I, II, III), in: Stella C. / Valzo, A. (Hg.): Studi in onore di Albino Garzetti, Brescia 1996, S. 49-71.
Bassignano, M. S.: Le flaminiche in Africa, in: Buonopane A. / Cenerini F. (Hg.): Donna e vita cittadina nella documentazione epigrafica. Atti del Il Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, Verona 25-27 marzo 2004, Faenza 2005, S. 399-429.
Bassignano, M. S.: Personale addetto al culto nella Venetia, in: Cresci Marrone, G. / Tirelli, M. (Hg.): Orizzonti del sacro. Culti e santuari antichi in Altino e nel Veneto orientale, Venezia 1-2 dicembre 1999, Rom 2001, S. 327-344.
Bassignano, M. S.: Sacerdozi femminilli nell´Italia settentrionale romana, Atti e Memorie dell´Ateneo di Treviso, n.s. 12, 1994/5, S. 71-82.
Bassignano, M. S.: Sacerdozi minori nella Venetia et Histria, in: Perini, S. (Hg.): Tempi, uomini ed eventi di storia veneta. Studi in onore di Federico Seneca, Rovigo 2003, S. 23-40.
Bauman, R. A.: Women and politics in Ancient Rome, London 1992.
Beard, M. / North, J. / Price, S.: Religions of Rome: A History, Cambridge 1998.
Benario, H. W.: Iulia Domna mater senates et patriae, Phoenix, 12, 1958, S. 67-70.
Benario, H. W.: The titulature of Julia Soaemias and Julia Mamaea. Two notes, TAPhA, 90, 1959, S. 9-14.
Benoit, F.: La statue d´Antonia niece d´Auguste et le culte de la domus divina au IIIe siècle à Cimiez, in: Mélanges A. Piganiol, Paris 1966, S. 369-381.
Benoist, S.: Rome, le prince et la Cité, Paris 2005.
Benseddik N.: Manus Ianis occupate… Femmes et métiers en Afrique, AntAfr, 45, 2009, S. 103-118, in part. 113-116.
Bertinelli Angeli, M. G.: Sacerdotes e culto imperiale a Luna e nella Cisalpina romana, Lunensia antiqua (= Storia Antica 9), Rom 2011, S. 469-483.
Beurlier, E.: Essai sur le culte rendu aux empereus, Paris 1890.
Bickermann, E. J.: Diva Augusta Marciana, AJPh, 95, 1974, S. 362-376.
Bielman, A.: Den Priester benennen, die Priesterin zeigen. Geschlecht und religiöse Rollen anhand griechischer Grabstelen aus der hellenistischen Epoche und der Kaiserzeit, in: Höpflinger, A.-K. / Jeffers A., Pezzoli-Olgiati D. (Hg.): Handbuch Gender und Religion, Göttingen 2008, S. 225-242.
Bielman A.: Femmes et religion en Asie mineure gréco-romaine. Recueil d'inscriptions grecques traduites et commentées, in: XIIIe congrès international d'épigraphie grecque et latine, Oxford, 2-7 septembre 2007, 2007.
Bielman, A. / Frei-Stolba, R.: Femmes et vie publique dans l´Antiquité greco-romaine, Etudes de Lettres, 1, Lausanne 1998.
Bielman, A. / Frei-Stolba, R.: Le statut public des prêtresses dans l’Antiquité un premier état de la question, in: Head A.-L. / Mottu-Weber L. (Hg.): Les femmes dans la société européenne. 8ème Congrès des historiennes suisses. Société d'Histoire et d'Archéologie, Genf 2000, S. 229-242.
Bielman, A. / Frei-Stolba, R.: Les flaminiques du culte impérial. Contribution au rôle de la femme sous ´Empire romain, Etudes de Lettres, 1994, S. 113-126.
Bremen, van R.: The Limits of Participation. Women and the Civic Life in the Greek East in the Hellenistic and Roman Periods, Amsterdam 1996 (= Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology 15).
Bremen, van R.: Women and Wealth, in: Cameron, A. / Kuhrt, A. (Hg.): Images of Women in Antiquity, London 1983, S. 222-243.
Briand-Ponsart C.: Autocélébration des femmes dans les provinces d´Afrique. Entre privé et public, in: Cébeillac-Gervasoni M. / Lamoine L. / Trément F. (Hg.): Autocélébration des élites locales dans le monde romain. Contexte, texts images, Clermont-Ferrand 2004, S. 171-186.
Buchholz, K.: Die Bildnisse der Kaiserinnen der severischen Zeit nach ihren Frisuren, Frankfurt am Main 1963.
Buonocore, M.: Evergetismo municipale femminile: alcuni asi dell´Italia centrale (regio IV), Donna E Vita Cittadina, 2005, S. 523-539.
Buonocore, M.: Un´inedita testimonianza di munificentia femminile a Teramo, Athenaeum, 86, 1998, S. 463-468.
Buonopane, A.: Una base opistografa dagli scavi del Capitolium di Verona, in: Angeli Bertinelli, A. / Donati, A. (Hg.): Varia Epigraphica. Atti del Colloquio Inter. di Epigrafia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000, Faenza 2001, S. 129-139.
Cenerini, F.: Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli impertori romani da Augusto a Commodo, Imola 2009.
Cenerini F.: Il culto di Livia Augusta tra Cirta e Leptis Magna, in L´Africa romana. Atti del XVII convegno di studio, Sevilla, 14-17 dicembre 2006, Roma 2008, S. 2233-2242.
Cenerini, F.: La donna romana. Modelli e realtà, Bologna 2002.
Cenerini, F.: La rappresentazione del ceto "intermedio" femminile: la scrittura epigrafica, in: Sartori, A. / Valvo, A. (Hg.): Ceti medi in Cisalpina. Atti del Colloquio inter. 14-16 settembre 2000, Milano, Milano 2002, S. 53-58.
Cenerini, F.: Le done di Sentinum al tempo dei Romani, Sentinum 295 A.C., 2008, S. 63-72.
Cenerini, F.: Le madri delle città, Donna E Vita Cittadina, 2005, S. 53-58.
Cenerini, F.: The Role of Women as Municipal Matres, Women and the Roman City, 2013, S. 9-22.
Chausson, F.: Deuil dynastique et topographie urbaine dans la Rome antonine. II. Temples des Divi de la dynastie antonine, in: Belayche, N. (Hg.): Rome, les Césars et la Ville aux deux premiers siècles de notre ère, Rennes 2001, S. 343-379.
Chelotti, M.: I sacerdozi nella region secunda augustea: il flaminato, Elites Municipales, 2000, S. 121-135.
Cid Lopez, R. M.: La presencia femenina en los cultos cívicos de la religion romana imperial. El caso de las flaminicae-divae, in: Alvar, J. / Blánquez, C. / Wagner, C. G. (Hg.): Ritual y conciencia civica en el Mundo Antiguo, Madrid 1995, S. 95-121.
Clauss, M.: Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich, Stuttgart 1999.
Corbier, M.: Impératrices et prêtresses. Des premiers rôles au féminin, in: Bielman, A. / Frei-Stolba, R. (Hg.): Femmes et vie publique dans l'Antiquité gréco-romaine Études de Lettres 1998,1, I-X.
Corbier, M.: L´uno e l´altro sesso. Epigrafia e frontiera di „gender“, Epigraphica, 67, 2005, S. 341-366.
Deininger, J.: Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr., München 1965.
Deininger, J.:Zur Begründung des Provinzialkultes in der Baetica, MDAI(M), 5, 1964, S. 167-179.
Duncan-Jones, R.: The chronology of the priesthood of Africa Proconsularis under the Principate, Epigraphische Studien 5, 1968, S. 39-65.
Eck, W.: Die Präsenz senatorischer Familien in den Städten des Imperium Romanum bis zum späten 3. Jahrhundert, in: Eck, W. / Galsterer, H. / Wolf, H. (Hg.): Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff, Köln 1980, S. 283-322.
Eck, W.: Frauen als Teil der kaiserzeitlichen Gesellschaft: ihr Reflex in Inschriften Roms und der italischen Städte, Women and the Roman City, 2013, S. 47-63.
Edelmann-Singer, B.: The Women of Akmoneia–revisited. Eine lokale Kaiserpriesterin in Asia aus augusteischer Zeit?, in: Edelmann-Singer, B. / Konen, H. (Hg.): Salutationes–Beiträge zur Alten Geschichte und ihrer Diskussion: Festschrift für Peter Herz zum 65. Geburtstag, S. 109-124.
Fishwick, D.: The institution of the imperial cult in Africa Proconsularis, Hermes, 92, 1964, S. 342-362.
Fishwick, D.: The Imperial Cult of the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire, 1987-2005.
Flory, M. B.: The Deification of Roman Women, The Ancient History Bulletin 9, 1995, S. 127-134.
Forbis, E.: Women´s Public Image in Italian Honorary Inscriptions, AJPh, 111, 1990, S. 493-512.
Forbis, E.: Liberalitas and Largitio. Terms for Private Munificence in Italian Honorary Inscriptions, Athenaeum, 81, 1993, S. 483-498.
Forbis, E. P.: Municipal Virtues in the Roman Empire. The Evidence of Italian Honorary Inscriptions, Stuttgart 1996.
Fraschetti, A.: Roma al femminile, Roma 1994.
Frei-Stolba, R.: Livie et aliae. Le culte des divi et leurs Prêtressses; Le culte des divae, in: Bertholet, F. / Bielman Sánchez, A. / Frei-Stolba, R. (Hg.): Egypte – Grèce – Rome. Les différents visages des femmes antique. Travaux et colloques du séminaire d’epigraphie grecque et latine de l’IASA 2002-2006, Bern et al. 2008 (Echo. Collection de l’Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne), S. 345-395.
Frija, G.: Les Prêtres des empereurs. Le culte impérial civique dans la province romaine d.’Asie, Rennes 2012.
Gayraud, M.: Les inscriptions de Julia Natalis à Narbonne, RAN, 3, 1970, S. 115-127.
Geiger, F.: De sacerdotibus Augustorum municipalibus, Halle 1913.
Gradel, I.: Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 2002.
Granino Cecere, M. G.: Flaminicae e sacerdotes del culto imperial nell´Italia romana: primi esiti di una ricerca in corso, Acta XII Congressus inter. Epigraphiae graecae et latinae, Barcelone 3-8 settembre 2002, Barcelona 2007, S. 643-654.
Granino Cecere, M. G.: Flaminicae imperiali ed euergetismo nell’italia Romana, in: Bertholet, F. / Bielman Sánchez, A. / Frei-Stolba, R. (Hg.): Egypte – Grèce – Rome. Les différents visages des femmes antique. Travaux et colloques du séminaire d’epigraphie grecque et latine de l’IASA 2002-2006, Bern et al. 2008 (Echo. Collection de l’Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité de l’Université de Lausanne), S. 265-287.
Granino Cecere, M. G.: Flaminicae imperiali ed euergetismo nell’italia Romana, Rom 2014 (Urbana Species. Vita di città nell’Italia e nell’Impero Romana 2).
Grether, G.: Livia and the Roman Imperial Cult, AJPh, 67, 1946, S. 222-252.
Grimm, G.: Zum Bildnis der Iulia Augusta, MDAI(R), 80, 1973, S. 279-282.
Gross, W. H.: Iulia Augusta. Untersuchungen zur Grundlegung einer Livia-Ikonographie, Göttingen 1962.
Guerra Gómez, M.: El sacerdocio femenino (en las religiones greco-romanas y en el cristianismo de los primeros siglos, Toledo 1987.
Hänlein Schäfer, H.: Veneratio Augusti. Eine Studie zu den Tempeln des ersten römischen Kaisers, Roma 1985.
Hahn, U.: Die Frauen des römischen Kaiserhauses und ihre Ehrungen im griechischen Osten anhand epigraphischer und numismatischer Zeugnisse von Livia bis Sabina, Saarbrücken 1994.
Hausmann, U.: Zu den Bildnissen der Domitia Longina und der Julia Titi, MDAI(R), 82, 1975, S. 315-328.
Hayward, C.: Les grandes- prêtresses du culte impérial provincial en Asie Mineure, état de la questin, in: Bielman, A. / Frei-Stolba, R. (Hg.): Femmes et vie publique dans l'Antiquité gréco-romaine, Études de Lettres Lausanne 1998,1, S. 117-130.
Hemelrijk, E.: City Patronesses in the Roman Empire, Historia, 53, 2004, S. 209-245.
Hemelrijk, E.: Fictive kinship as a metaphor for women´s civis roles, Hermes, 138, 2010, S. 455-469.
Hemelrijk, E.: Hidden lives, public personae. Women and civic life in the roman west, Oxford 2015.
Hemelrijk, E.: Imperial Priestesses, a Preliminary Survey, in: Blois L. de / P. Funke / J. Hahn (Hg.): The Impact of Imperial Rome on Religions, Ritual and Religious Life in the Roman Empire: Proceedings of the Fifth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C.-A.D. 476), Münster, 30.6.-4.7. 2004, Leiden, 2006, S. 179-193.
Hemelrijk, E.: Local Empresses. Priestesses of the Imperial Cult in the cities of the Latin West, Phoenix, 61, 2007, S. 318-351.
Hemelrijk, E.: Matrona docta. Educated Women in the Roman élite from Cornelia to Iulia Domna, London 1999.
Hemelrijk, E.: Priestesses of the Imperial Cult in the Latin West: Titles and Function, L'Antiquité Classique, 74, 2005, S. 137-70.
Hemelrijk, E.: Priestesses of the imperial cult in the Latin West. Benefactions and public honour, L'Antiquité Classique, 75, 2006, S. 85-117.
Herz, P.: Asiarchen und Archiereia, zum. Provinzialkult der Provinz Asia, Tyche 7, 1992, S. 93-115.
Herz, P.: Kaiserfeste der Prinzipatszeit, ANRW, II, 16.2, 1978, S. 1135-1200.
Huet, V.: Des femmes au sacrifice: quelques images romaines, in: Mehl, V. / Brulé, P. (Hg.): Le sacrifice antique. Vestiges, procédures et stratégies, Rennes 2008, S. 81-107.
Kajava, M.: A New City Patroness?, Tyche, 5, 1990, S. 27-36.
Kolb, A. (Hg.): Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? Akten der Tagung in Zürich 18.-20. 9. 2008, Berlin 2010.
Kron, U.: Priesthoods, Dedications and Euergetism. What Part Did Religion play in the Political and Social Status of Greek Women?, in: Hellstrøm, P. / Alroth, B. (Hg.): Religion and Power in the Ancient Greek World. Proceedings of the Usssala Symposium 1993. (Boreas 24), Uppsal 1996, S. 139-182.
Ladage, D.: Städtische Priester- und Kultämter im lateinischen Westen des Imperium Romanum zur Kaiserzeit, Köln 1971.
Ladjimi-Sebaï, L.: À propos du flaminat féminin dans les provinces africaines, MEFRA, 102, 1990, S. 651-686.
Ladjimi-Sebaï, L.: La femme en Afrique à l époque romaine (à partir de la documentation épigraphique), Tunis 2011 (in part. pp. 211-221).
Les Flavii de Cillium. etude architectural, épigraphique, historique et littéraire du Mausolée de Kasserine (CIL VIII, 211-216), Paris 1993.
Letta, C.: rec. a M. Clauss, Kaiser und Gott, Athenaeum, 99, 2002, S. 625-632.
MacMullen, R.: Woman in Public in the Roman Empire, Historia, 29, 1980, S. 208-218.
McIntyre, G.: A Family of Gods. The worship of the imperial Family in the Latin West, Ann Arbor 2016.
Mucznik, S.: Roman Priestesses. The Case of Metilia Acte, Assaph: Studies in Art History 4 1999, S. 61-78.
Nicols, J.: Patrona civitatis. Gender and Civis Patronage, Studies in Latin Literature and Roman History, Brüssel 1989.
Paci, G.: Tiberio e il culto imperiale, Nuove Ricerche, 2008, S. 193-218.
Panzram, S.: Stadtbild und Elite. Tarraco, Corduba und Augusta Emerita zwischen Republik und Spätantike, Stuttgart 2002 (Historia Einzelschriften 161), S. 50ff zu den flaminicae in flavischer Zeit.
Peppel, M.: Gott oder Mensch? Kaiserverehrung und Herrschaftskontrolle, in: Cancik, H. / Hitzl, K. (Hg.): Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen, Tübingen 2003, S. 6-95.
Polaschek, K.: Studien zu einem Frauenkopf im Landesmuseum Trier und zur weiblichen Haartracht der iulisch-claudischen Zeit, mit einem Exkurs zur Ikonographie einer Caligulaschwester, TZ, 35, 1972, S. 141-210.
Polaschek, K.: Studien zur Ikonographie der Antonia Minor, Rom 1973.
Polaschek, K.: Porträttypen einer claudischen Kaiserin, Rom 1973.
Poulsen, V.: Portraits of Claudia Octavia, Opuscula Romana, 4, 1962, S. 107-115.
Price, S. R. F.: Rituals and Power. The Roman imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984.
Price, S. R. F.: From Noble Funerals to Divine Cult. The Consecration of Roman Emperors, in: Cannadine, D. / Price, S. R. F. (Hg.): Rituals of Royalty: Power and Ceremonials in Traditional Societies, Cambridge 1987, S. 56-106.
Raepsaet-Charlier, M.-T.: Les sacerdoces des femmes sénatoriales sous le Haut-Empire, in: Baslez, M. F. / Prèvot, F. (Hg.): Prosopographie et histoire religieuse. Acte du Colloque tenu en l´Université Paris XII-Val de Marne, les 27 et 28 octobre 2000, Paris 2005, S. 283-304.
Rosenbach, M.: Galliena Augusta. Einzelgötter und Allgott im gallienischen Pantheon, Tübingen 1958.
Sadurska, A.: Un portrait idéalisé d´Antonia Augusta au Musée National de Varsovie, Acta Conventus XI Eirene, Warschau 1971, S. 499-506.
Saller, R. P.: Personal patronage under the early empire, Cambridge 1982.
Scheid, J.: The religious Roles of Roman Women, in: Schmitt Pantel, P. (Hg.): A History of Women in the west, I. From ancient Goddesses to Christian Saints, Cambridge 1992, S. 377-408.
Scheid, J.: Hiérarchie et structure dans le polythéisme romain. Facons romaines de penser l´action, Archiv für Religionsgeschichte, 1, 1999, S. 184-203.
Scheid, J.: Honorer le prince et vénérer les dieux: culte public, cultes des quartiers et culte impérial dans la Rome augustéenne, in: Belayche, N. (Hg.): Rome, les Cèsars et la Ville aux deux premiers siècles de notre ère, Rennes 2001, S. 85-115.
Scheid, J.: Les rôles religieux des femmes à Rome. Un complément, in: Frei Stolba, R. / Bielman, A. / Bianchi, O. (Hg.): Les femmes antiques entre sphère privée et sphère publique, Echo 2, Bern 2003, S. 137-151.
Scheid, J.: Comprendre le culte dit impérial. Autour de deux livres récents, AC, 73, 2004, S. 239-249.
Schultz, C. E.: Women´s Religious Activity in the Roman Republic, Chapel Hill 2006.
Siebert, A. V.: Quellenanalytische Bemerkungen zu Haartracht und Kopfschmuck römischen Priesterinnen, Boreas, 18, 1995, S. 77-92.
Spickermann, W.: Priesterinnen im römischen Gallien, Germanien und in den Alpenprovinzen (1.-3. Jh. n.Chr.) Historia, 43, 1994, S. 189-240.
Stepper, R.: Zur Rolle der römischen Kaiserin im Kultleben, in: Kunst, C. / Riemer, U. (Hg.): Grenzen der Macht der Rolle der römischen Kaiserfrauen, Stuttgart 2000, S. 61-72 (PawB 3).
Thirion, M.: Faustina Augusta, Mater Castrorum, GNS, 17, 1967, S. 41-49.
Torelli, M.: Donne, domi nobiles et evergeti a Paestum tra la fine della Repubblica e l’inzio dell’Imperio, in: Cébeeillac, / Gervasoni, M. (Hg): Les élites municipales de l’Italie péninsulaire des Gracques à Neron, Actes de la table-ronde de Clermont-Ferrand 28-30 novembre 1991, Rom 1996(CEFRA 215), S. 153-178.
Trillmilch, W.: Zur Formgeschichte von Bildnistypen, JDAI, 86, 1971, S. 179-213.
Trillmilch, W.: Ein Bildnis der Agrippina Minor von Milreu/Portugal, MDAI(M), 15, 1974, S. 184-202.
Turner, J. A.: Hiereiai. Acquisition of Feminine Priesthoods in Ancient Greece, Univ. Calif. Santa Barbara 1983, Ann Arbor fac. simile microfilms 1985.
Vangaard, J. H.: The flamen. A Study in the History and Sociology of Roman Religion, Copenhagen 1988.
Varner, E. R.: Portraits, Plots and Politics: damnatio memoriae and the Images of Imperial Women, MAAR, 46, 2001, S. 41-93.
Wessels, K.: Das Kaiserinnenporträt im Castello Sforzesco zu Mailand, JDAI, 77, 1962, S. 240-255.
Winkes, R.: Leben und Ehrungen der Livia. Ein Beitrag zur Entwicklung des römischen Herrscherkultes von der Zeit des Triumvirats bis Claudius, Archeologica 36, 1985, S. 55-68.
Wood, S. E.: Imperial women. A study in public images 40 B.C. – A.D. 68, Leiden 1999.
Zimmer, G.: Locus datus decreto decurionum. Zur Statuenaufstellung zweier Forumsanlagen im römischen Afrika. Mit epigraphischen Beiträgen von Wesch-Klein Gabriele, München 1989.
Literaturliste Prosopographie und Netzwerkforschung
Bearman, P. S.; Moody, J. / Faris, R.: Networks and History, Complexity, 8, 2002, S. 61-71.
Bixler, M. / Reupcke, D.: Von Quellen zu Netzwerken, in: Düring, M. / Eumann, U. (Hg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen zur Methodenforschung, 1), Berlin u.a. 2016, S. 101-122.
Bulst, N.: Zum Gegenstand und zur Methode von Prosopographie, in: Bulst, N. / Genet, J.-P. (Hg.): Medieval lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography (Proceedings of the First International Interdisciplinary Conference on Medieval Prosopography. University of Bielefeld, 3-5 December 1982), Kalamazoo 1986, S. 1-16.
Cameron, A. (Hg.): Fifty Years of Prosopography. The Later Roman Empire, Byzantium and Beyond, Oxford 2003.
Csendes, P.: Stadt und Prosopographie. Zur quellenmäßigen Erforschung von Personen und sozialen Gruppen in der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, Linz 2002.
Düring, M. / Stark, M.: Historical Network Analysis, in: Barnett, G. A. (Hg.): Encyclopedia of Social Networks, London 2011.
Düring, M. / Eumann, U.: Historische Netzwerkforschung. Ein neuer Ansatz in den Geschichtswissenschaften, in: Geschichte und Gesellschaft, 3, 2013, S. 369-390.
Düring, M. / Keyserlingk, L. von: Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften. Historische Netzwerkanalyse als Methode für die Erforschung von historischen Prozessen, in: Schützeichel, R. / Jordan, S. (Hg.): Prozesse. Formen, Dynamiken, Erklärungen, Wiesbaden 2015, S. 337-350.
Eck, W. (Hg.): Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie. Kolloquium Köln 24.-26. November 1991, Köln 1993.
Erickson, B. H.: Social Networks and History. A Review Essay, Historical Methods 30, 1997, S. 149-157.
Gamper, M.: Soziale Netzwerke und Macht. Eliasʼ Konzept der Figuration vor dem Hintergrund des Aufstiegs der Medici in Florenz, in: Düring, M. / Gamper, M. / Reschke, L. (Hg.): Knoten und Kanten III. Soziale Netzwerkanalyse in der Geschichts- und Politikforschung, Bielefeld 2015, S. 81-108.
Gramsch, R.: Pariser Studienkollegen und römische Verbindungen. Das Personennetzwerk um Erzbischof Albrecht II., in: Puhle, M. (Hg.): Aufbruch in die Gotik. Der Magdeburger Dom und die späte Stauferzeit. Essayband zur Ausstellung Magdeburg 2009, Mainz u.a. 2009, S. 384-391.
Gramsch, R.: Politische als soziale Grenzen? „Nationale“ und „transnationale“ Heiratsnetze des deutschen Hochadels im Hochmittelalter, in: Bock, N / Jostkleigrewe, G. / Walter, B. (Hg.): Faktum und Konstrukt. Politische Grenzen im europäischen Mittelalter. Verdichtung. Symbolisierung. Reflexion (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des SFB 496, 35), Münster 2011, S. 27-42.
Gramsch, R.: Das Reich als Netzwerk der Fürsten. Politische Strukturen unter dem Doppelkönigtum Friedrichs II. und Heinrichs (VII.) 1225-1235, in: Mittelalter-Forschungen 40, Ostfildern 2013.
Gramsch, R.: Autorität im Netzwerk der Fürsten. Friedrich II. und Heinrich (VII.) im Anerkennungswettstreit (1231-1235), in: Seibert, H. / Bomm, W. / Türck, V. (Hg.): Autorität und Akzeptanz. Das Reich im Europa des 13. Jahrhunderts, Ostfildern 2013, S. 43-64.
Gramsch, R.: Prosopographische Auswertung der päpstlichen Briefregister. Individualbiographien und Klerikernetzwerke im Spätmittelalter, in: Berndt, R. (Hg.): „Eure Namen sind im Buch des Lebens geschrieben“. Antike und mittelalterliche Quellen als Grundlage moderner prosopographischer Forschung (Erudiri Sapientia: Studien zum Mittelalter und zu seiner Rezeptionsgeschichte, 11), Münster 2014, S. 167-180.
Gramsch, R.: Zerstörter oder verblasste Muster? Anwendungsfelder mediävistischer Netzwerkforschung und das Quellenproblem, in: Düring, M / Eumann, U. (Hg.): Handbuch Historische Netzwerkforschung. Grundlagen und Anwendungen (Schriften des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen zur Methodenforschung, 1), Berlin u.a. 2016, S. 85-99.
Jahnke, C.: Handelsnetze im Ostseeraum, in: Fouquet, G. / Gilomen, H.-J. (Hg.): Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters (Vorträge und Forschungen, 62), Ostfildern 2010, S. 189-212.
Jansen, D.: Einführung in die Netzwerkanalyse. Grundlagen, Methoden, Forschungsbeispiele, 3. Aufl., Wiesbaden 2006. (Grundbegriffe der sozialen Netzwerkforschung)
Keats-Rohan, K.S.B. (Hg.): Prosopography, Approaches and Applications. A Handbook (= Prosopographica and Genealogica. Band 13), Oxford 2007.
Jullien, E.: Netzwerkanalyse in der Mediävistik. Probleme und Perspektiven im Umgang mit mittelalterlichen Quellen, VSWG 100, 2013, S. 135-153.
Kocka, J.: Theories and quantification in history, Social Science History, 8, 1984, S. 169-178.
Lemercier, C.: Formale Methoden der Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften: Warum und Wie?, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 23, 2012, S. 16–41.
Nitschke, C.: Netzwerkmanagement im Ostgotenreich. Die Verweigerung des konfessionellen Konflikts durch Theoderich den Großen, in: Bauerfeld, C. / Clemens, L. (Hg.): Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike bis zur Gegenwart, Bielefeld 2014, S. 87-117.
Nowak, J.: Der Codex des Rolando Talenti. Abbild eines wahrhaften "Netzwerkes" oder Spiegel eines bemerkenswerten Kunstwerkes?, in: Hitzbleck, K. / Hübner, K. (Hg.): Die Grenzen des Netzwerks 1200-1600, Ostfildern 2014, S. 65-92.
Preiser-Kapeller, J.: Großkönig, Kaiser und Kalif. Byzanz im Geflecht der Staatenwelt des Nahen Ostens, 300-1204, Historicum. Zeitschrift für Geschichte, 1, 2012, S. 26-47. (Grundbegriffe der sozialen Netzwerkforschung)
Reinhard, W.: Freunde und Kreaturen. “Verflechtung” als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600 (Schriften des philosophischen Fachbereichs der Universität Augsburg, 14), Augsburg 1979, S. 5-41. (Theorie der Historischen Netzwerkforschung)
Reitmayer, M. / Marx, C.: Netzwerkansätze in der Geschichtswissenschaft, in: Stegbauer, C. / Häußling, R. (Hg.): Handbuch Netzwerkforschung (= Netzwerkforschung). Band 4, Wiesbaden 2010, S. 869ff.
Stark, M.: Netzwerke in der Geschichtswissenschaft, in: Hergenröder, C. W. (Hg.): Gläubiger, Schuldner, Arme, Netzwerke und die Rolle des Vertrauens, Wiesbaden 2010, S. 187-190.
Vössing, K. (Hg.): Biographie und Prosopographie. Internationales Kolloquium zum 65. Geburtstag von Anthony R. Birley (=Historia Einzelschriften 178), Stuttgart 2005.
Wasserman, S.: Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge 1994.
Wellman, B. / Berkowitz, S. (Hg.): Social Structures. A Network Approach. Structural Analysis in the Social Sciences 2, Cambridge 1998.
Zaunstöck, H. / Meumann, M.: Sozietäten, Netzwerke, Kommunikation. Neue Forschungen zur Vergesellschaftung im Jahrhundert der Aufklärung. De Gruyter 2003.
Workshop zur Prosopographie
Workshop ‚Kritische Prosopographie und historische Biographik‘ vom 04.-06.11.2021 (Technische Universität Bergakademie Freiberg) mit einem Vortrag von Dr. Nicole Diersen zum Thema "Das Projekt ‚Römische Kaiserpriesterinnen‘: Eine prosopographische Studie auf der Grundlage von epigraphischen Datensätzen in den Altertumswissenschaften" mit anschließender Publikation (siehe Ergebnisse).
Exkursion nach Regensburg
Im Juni 2017 hat sich die Projektgruppe auf den Weg nach Regensburg gemacht, um gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Edelmann-Singer und Frau Dr. Köstner einen Workshop zu gestalten. Während unsere Projektgruppe sich vorrangig mit den Kaiserpriesterinnen der westlichen römischen Provinzen auseinandersetzt, beschäftigen sich Frau Prof. Dr. Edelmann-Singer und Frau Dr. Köstner mit den Kaiserpriesterinnen der östlichen Provinzen; daher bot sich ein Austausch über Methoden, Inhalte und Hilfsmittel sehr gut an. Im ersten Teil des Workshops stellte unsere Gruppe Soziogramme sowie Ergebnisse der Georeferenzierung vor, wobei die Regensburger im zweiten Teil eine Einführung in die historische Netzwerkanalyse darboten sowie Einblick in ihren derzeitigen Forschungsstand gaben.
Neben dem Workshop waren kulturelle und kulturgeschichtliche Programmpunkte Teil der Exkursion. Wir hatten die Gelegenheit, mit der navis lusoria auf der Naab, einem Zufluss der Donau, zu fahren. Die navis lusoria ist der Nachbau eines antiken Flusskriegsschiffs,das als Patrouillenboot diente und im Jahre 2004 zum Großteil von Studierenden der Alten Geschichte innerhalb der Philosophischen Fakultät der Universität Regensburg fertiggestellt wurde.
Darüber hinaus besichtigten wir im Rahmen einer Führung das document niedermünster, das unter der gleichnamigen Kirche gelegen ist. Anhand der einzelnen Ausgrabungsschichten lassen sich das römische Militärlager castra regina, die Fundamente der Welterbestadt Regensburg, die Pfalzkapelle des Herzogs von Baiern (sic) und die Kirche des adeligen Damenstifts Niedermünster erkennen und rekonstruieren; es lässt sich dort also die historische Entwicklung vom 2. bis ins 12. Jahrhundert nachzeichnen.
Des Weiteren hatten wir Gelegenheit, die Abteilung „Römisches Regensburg“ des Historischen Museums zu besuchen sowie die Walhalla, ein klassizistisches Bauwerk Königs Ludwigs I., das als Gedächtnisort für deutschsprachige Männer und Frauen dienen sollte.