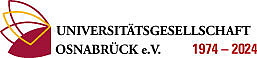Projekt In (E)motion: Emotionen als Motor der antiken Welt

Das Projekt In (E)motion
Die Projektgruppe „In (E)motion“ fand sich auf der gleichnamigen Tagung (siehe unten) zusammen. Sie beschäftigt sich mit Fragen zur antiken Emotionsgeschichte aus allen Themenbereichen der Altertumswissenschaften, wie etwa der Politik, Militär und Geschlecht. Dabei fragt sie nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Emotionen in Ausdruck, Handeln und Praxis. So wird etwa danach geforscht, inwiefern sich Furcht im militärischen Kontext von Furcht im geschlechterspezifischen Vergleich, etwa in Epen und Tragödien, unterscheiden oder welche Emotionsstrategien im Politischen angewandt werden. Etablierte Forschende wie Douglas Cairns, Dennis Pausch, Christiane Kunst und Meike Rühl bereichern die Forschungsgruppe, die u.a. der Nachwuchsförderung dient, mit ihrer Expertise.
Koordination: Nicole Diersen
Mitglieder der Projektgruppe
Dalida Agri (Cambrige)
Mario Baumann (Dresden)
Douglas Cairns (Edinburgh)
Bernadette Descharmes (Rostock)
Anna-Lisa-Fichte (Dresden)
Ide François (Leuven)
Lennart Gilhaus (Bonn / Essen)
Simon Grund (Tübingen)
Isabelle Künzer (Gießen / Leuven)
Asuman Lätzer-Lasar (Marburg)
Anne-Sopie Meyer (Toronto / Straßburg)
Marian Nebelin (Chemnitz)
Seraina Ruprecht (Bern)
Florian Sittig (Köln)
Dennis Pausch (Marburg)
Anna-Dorothea-Uschner (Dresden)
Christin Wagner (Hannover)
Tagung: In (E)motion: Emotionen als Motor der antiken Welt
16.01.2025, ab 17:30 - 18.01.2025 • präsent im Raum 11/E06
Organisation und Kontakt: Dr. Nicole Diersen
Zum Programmplakat (PDF, 419 kB)
Die Tagung soll einen Beitrag dazu leisten, für neue Forschungszugänge aus der Emotionsforschung in den Altertumswissenschaften zu sensibilisieren und an interdisziplinären Fallbeispielen ihren Mehrwert für die altertumswissenschaftliche Forschung unter Beweis zu stellen. Das Ziel der Tagung ist es, den vielfältigen Einsatz von Emotionen sowie deren Potentiale für die Forschung aufzuzeigen. Als etabliert geltende inhaltliche wie methodische Arbeiten zu Themenbereichen wie Politik, Recht und Kult, Gewalt und Militär, Geschlecht und Familie sowie Dichtung und Literatur sollen in ihren Strukturen aufgebrochen werden. Denn sie sind keine von Emotionen isolierten Bereiche, sondern werden im Gegenteil von Emotionen mitgeprägt. Dabei werden neue Perspektiven eröffnet. Die Emotionsgeschichte ersetzt damit keinesfalls die bisherige Forschung, sondern erweitert komplementär das bestehende Geschichtsbild zur Antike. Weder lassen sich in der Geschichtswissenschaft Emotionen allein denken, noch lassen sich andere altertumswissenschaftliche Disziplinen ohne Berücksichtigung von Emotionen durchführen. Beide Aspekte sind zwangsläufig miteinander verbunden, wie die Beiträge der Tagung zeigen.
Gefördert durch: